Wieder mal 'karierte Deckchen'-Zeit...

In der letzten Zeit denk ich wieder ziemlich viel an meine letzte „Heim-Station“, und die Erinnerungen sind überwiegend freundlicher Art. Hängt vielleicht damit zusammen, daß ich z.Zt. wieder sehr viel über „normal“ bzw. „nicht normal“ sinniere, das passiert vor allem dann, wenn ich mit Situationen konfrontiert bin, die ich nicht kenne und wo ich mich manchmal nicht fragen traue, weil es anderen vielleicht komisch vorkommt, wenn ich „normale Sachen“ nicht kenne. Andersrum isses für andere vielleicht auch interessant zu erfahren, wie so ein Leben außerhalb des Elternhauses „funktioniert“, unter „Heim“ stellen sich die meisten doch irgendwas Exotisches vor. Na, ich leg mal los.
Das Heim, in dem ich zuletzt war, gibt es nicht mehr, es ist schon vor Jahren unter ziemlichen Schlagzeilen aufgelöst worden – die Boulevardpresse berichtete damals von „Exorzismus“ und ähnlichem Zeugs, ich denke mal, es war in seiner Struktur vielleicht einfach nicht mehr zeitgemäß, vielleicht spielte auch eine Rolle, daß es von katholischen Ordensfrauen – den Schwestern vom Guten Hirten – geführt wurde und es in der heutigen Zeit immer schwieriger wird für solche Orden, Nachwuchs und damit auch genügend qualifizierte Erzieherinnen für die Mädchen zu finden. Wie auch immer: nur vermutet. Für mich jedenfalls waren die zwei Jahre dort die besten, die ich in meiner Kindheit und Jugend verbracht hab, es war auch die Zeit, die mir im Rückblick das meiste an positiven Wegweisern mit ins Leben gegeben hat.
St. Gabriel war als „Heim für gefallene Mädchen“ in der Umgebung bekannt, es war offiziell eine „heilpädagogische Einrichtung“ - das hab ich allerdings erst letztes Jahr erfahren, als mir andere Ehemalige erzählt haben, daß es nicht als „geschlossenes Heim“ galt, wie ich immer dachte. Mag vielleicht offizielle Richtlinien dazu geben, nach meinem Erleben war's ein geschlossenes Heim: abends wurden die Jalousien in den Schlafzimmern zugesperrt, um zu verhindern, daß wir ausbüxen, man konnte das Gelände nur durch eine Pforte verlassen, die nachts zugesperrt war und wo man tagsüber nicht ohne Kontrolle raus konnte. Ein- und ausgehende Briefe und Päckchen wurden von der Gruppenschwester gelesen und kontrolliert, das eine Mal, wo ich von dort ausgebüxt bin, hab ich mich durch die dichte Hecke, die das gesamte Gelände umgab, durchgedrückt – um dort dort festzustellen, daß in dieser Hecke ein Stacheldrahtzaun verborgen war. Nicht unüberwindlich, aber doch ziemlich pieksig so im Dunkeln.

Nach St. Gabriel bin ich gekommen, als ich 17 Jahre alt war, nachdem ich noch zwei Mal vom Mädchenwohnheim abgehauen bin, das letzte Mal hat mich die Polizei nach mehreren Wochen „aufgegriffen“: sie hatten mich in der Wohnung einer Bekannten, bei der ich untergeschlüpft war, aufgestöbert, artig geklingelt und mich aufgefordert, mitzukommen. Altklug, wie ich damals war, fragte ich: „Was liegt gegen mich vor?“ -

- den Satz hatte ich aus irgend 'nem Krimi aufgeschnappt und kam mir sehr erwachsen vor. Fanden die Polizisten nicht, die haben mich einfach ausgegrinst und auf's Auto gedeutet. Wichtigtuer.


Ich wurde erstmal zu einer Jugendamtsstelle – oder war's doch Polizei? Weiß ich nicht mehr – gebracht und dort in eine Arrestzelle gesperrt, die genauso aussah wie der Knast, in dem ich zwei Jahre zuvor mal einen Teil meiner Sommerferien abgesessen hab: weiß gekachelt, eine an der Wand festgeschraubte Pritsche mit dünner Matratze, ein Waschbecken, ein Klo und ein Spion in der Tür.
Anders als den Jugendarrest fand ich diesmal das Eingesperrtsein schlimm: niemand hatte mir gesagt, für wie lange ich dort sein sollte und wie es überhaupt mit mir weitergehen würde. Als ich dort so saß, überkam mich das heulende Elend, mir wurde bewußt, daß ich auf dem besten Weg war, „in der Gosse“ zu landen, wie mir das immer prophezeit worden war, weil ich mit meinen 17 eigentlich schon in einem Alter war, wo das Jugendamt nicht mehr so erpicht darauf war, eine ständige Trebegängerin immer wieder einzusammeln und für ihren Lebensunterhalt aufzukommen. Schulabschluß hatte ich keinen, und die vorangegangenen Wochen hatte ich ein Leben kennengelernt, das abenteuerlich, aber alles andere als das war, von dem ich geträumt hatte: teilweise auf der Straße und für Geld, Schlafplätze, Mitfahrgelegenheiten prostituiert, dann auch in einer Kneipe untergeschlüpft, deren Wirt mir ein kleines Kammerl und Verpflegung zur Verfügung gestellt hat, wofür ich täglich von 10 bis 4 Uhr nachts gearbeitet hab – es war eine türkische Kneipe, in der ausschließlich Männer verkehrten, Frauen hatten dort – wenn überhaupt – nur mit Kopftuch und gesenkten Augen Zutritt. Dem entsprechend „begehrt“ war ich da.
Na, wie auch immer: all das ging mir so durch den Kopf in dieser Arrestzelle, auch, daß meine Träume von Ausbildung, selbstbestimmtem Leben usw. ziemlich auf der Kippe standen, und ich fand mein Leben verpfuscht und überlegte, mir die Pulsadern aufzuschneiden. Gab aber nix, womit ich das hätte machen können außer meinen Brillengläsern, außerdem dachte ich, daß es ziemlich beschissen wäre, zu sterben, bevor ich rausgefunden hatte, wie sich ein glückliches Leben anfühlt.
Also heulte ich die Nacht so rum, bis mich in der Früh jemand vom Jugendamt aus der Zelle holte, mir ein Frühstück gab, mir dann ohne viel Trara ein Zugticket und einen Zettel mit den Stationen, an denen ich umsteigen mußte, in die Hand drückte und sagte: „Wir werden nicht kontrollieren, ob du unterwegs abhaust, aber wenn du's tust, werden wir dich auch nicht mehr suchen lassen. Es liegt also jetzt bei dir, ob du zurückfährst oder nicht“.
Ganz neue Töne, ehrlich gesagt hat mich das noch mehr erschreckt als davor immer die Angst, von der Polizei aufgegabelt zu werden.
Ich fuhr also zurück, bin nicht ausgebüxt und fand es ziemlich ungemütlich, nicht zu wissen, ob man mich nun aufgeben würde oder nicht.
Zurück in Augsburg in dem Mädchenwohnheim kamen auch keine Vorhaltungen, nur wieder mal die Enttäuschung der Leiterin, was mich selbst mal wieder ziemlich schofelig fühlen ließ, und die Ankündigung, man würde mit mir am nächsten Tag in die Einrichtung, in der ich meine Kindheit verbracht hatte, fahren, um dort zu besprechen, was nun weiter aus mir werden sollte. Dort jedenfalls wollte man mich nicht mehr haben, von der Realschule, auf die ich mittlerweile gewechselt war, bin ich wegen Schwänzen wieder mal gefeuert worden, und es war die Rede davon, daß ich in Augsburg in ein anderes Heim kommen sollte. Als ich das hörte, wurde mir eiskalt, weil: ich hatte, bevor ich ausgebüxt war, bereits in Augsburg angefangen, ein Doppelleben zu führen: tagsüber das beliebte, pfiffige Schulmädel, nachmittags und abends aber immer häufiger in einer Bar, in der Zuhälter, Kriminelle, nur wenige Frauen, aber viele gestrandete Existenzen abhingen. Diese Bar war nur wenige Meter vom Königsplatz entfernt, und bei der Vorstellung, wieder in diese Kreise zurückzukehren und zugleich mein Schulmädeldasein wieder aufzunehmen, wurde mir ganz schlecht.
Um das zu verhindern, behauptete ich, schwanger zu sein. Ich wußte, es gab in München ein Mutter-Kind-Heim, und ich dachte mir: wenn ich erstmal in München bin und der Schwindel rauskommt, wird sich schon eine neue Möglichkeit finden, vielleicht sogar eine eigene Wohnung, ich näherte mich meiner Volljährigkeit ja schon ziemlich.
Tja – Schuß ins Knie, könnte man sagen, weil: wie erhofft, wurde tatsächlich nicht lange gefackelt, binnen kürzester Zeit wurde beschlossen, mich in dieses Mutter-Kind-Heim zu verfrachten, und erst als ich dort ankam, erfuhr ich, was für eine Einrichtung das wirklich war: St. Gabriel. Lauter Ordensfrauen dort, beim Reinkommen herrschte da schon so 'ne klösterliche Atmosphäre, ich dachte, sowas gäb's nur im Film.

Wurde aber noch besser: bei der Aufnahme erklärte man mir die „Grundregeln“: die Neuen kamen erstmal in ein Dreibett-Zimmer. Die Neuen durften keine Minute allein sein, jeder Weg innerhalb des Geländes mußte mit einer Schwester oder einem der älteren Mädchen gemacht werden. Der Tag vom Aufstehen bis zum Schlafengehen war so durchgeplant, daß keine freie Minute blieb. Enge Freundschaften – sie nannten das dort „Bappschaften“ - zwischen den Mädchen waren unerwünscht. Kein Ausgang, kein Bargeld – das Taschengeld wurde von den Schwestern verwaltet, wenn man was wollte, mußte man das von der Schwester erbitten, sie hat dann die Einkäufe vom Taschengeld erledigt. Keine Schimpfwörter – jedes Schimpfwort kostete 5 Mark, die an Misereor gespendet wurden. Keine Schläge – an den „Tarif“ dafür erinnere ich mich nicht mehr, war aber sicher auch mit Taschengeld verbunden. Und dann der Knüller: als ich fragte, ob wenigstens das Rauchen erlaubt wäre, wurde mir gesagt: „Ja, eine am Tag“. Ich Schnellmerker fragte: „Eine Schachtel?“ - fand ich zu wenig. Ne. Eine Zigarette.

- die gab's am Abend nach dem Abendessen, die Schwester hat die einzeln verteilt.
Bei Übertretungen, Versäumnissen, was auch immer: Zigarettenentzug. Ebenso Fernsehen: wir durften abends gelegentlich fernsehen, wenn es ein „anständiger Film“ war – Krimis gehörten nicht unbedingt dazu. Aber Sissi.

Als ich mir das alles so anhörte und mich umsah, dachte ich so bei mir: „Gut, in spätestens 2 Tagen bin ich hier weg, den Knast muß ich nicht haben“, und fing schon mal an, mich nach geeigneten Fluchtwegen umzusehen. Und dann lernte ich meine Gruppenschwester kennen: eine kleine, dunkle, quirlige Inderin mit riesigen, lachenden Kulleraugen, die mich mit in die Gruppe nahm, mir dort ihren großen Schlüsselbund in die Hand drückte und sagte: „Du wirst doch nicht weglaufen, so lange ich weg bin, ich vertraue dir!“ - und dann verschwand die einfach und ich stand da wie' begossener Pudel und dachte nur: Schöne Scheiße.
Also blieb ich halt. Für's erste jedenfalls.

Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viele Gruppen es in St. Gabriel gab, es werden so 10 – 12 gewesen sein, nur zwei davon bildeten das Mutter-Kind-Heim für minderjährige Mütter. Die jüngste, die ich dort kennengelernt hab (da war sie allerdings schon volljährig), hatte ihre Tochter mit 11 Jahren entbunden, das Kind hatte ihr Vater gezeugt. Es gab einige Mädels dort, die so wie ich auf der Straße gelebt hatten, mehr aber solche, deren Eltern mit ihnen nicht klargekommen waren. Je länger ich die kannte, umso mehr erfuhr ich, daß es ziemlich beschissene Eltern gibt – sorry, wenn ich das so sag, aber war wirklich so. Kaltschnäuzige, bösartige, unbelehrbare Mädels hab ich dort jedenfalls keine kennengelernt, aber ziemlich viele verzweifelte. Hat meine Traumwelt über Eltern und Kinder ziemlich zerstört.
Eines der ersten Dinge, die ich in St. Gabriel erlebte, war das „Einweisungsritual für Neue“: am Abend war Gruppenschwimmen angesagt, im Heim gab es ein kleines, schönes Schwimmbad, und gelegentlich gingen wir dort unter Aufsicht der Schwester zum Schwimmen. Ein Lichtblick! Allerdings erklärte man mir, daß wir nicht im Badeanzug oder Bikini dort rein dürften, sondern nur mit Schlafanzug oder Nachthemd. So'n Mist, ich dachte, die Katholen wären schon bissl sehr prüde, aber na gut, besser mit Nachthemd als gar nicht Schwimmen...
Glaub, so naiv, das zu glauben, ist hier außer mir niemand, oder?

- diese Mistbienen haben mich tatsächlich die ganze Stunde im Schlafanzug meine Runden drehen lassen und sind selbst auch im Nachtgewand rumgepaddelt. Sr. M. hat sich scheckig gelacht.

Und dann ging mein Alltag dort los. Täglich um halb 7 aufstehen, anziehen, Morgendienste – turnusmäßig mußte jede irgend was machen: Gang putzen, Wohnzimmer wischen und staubsaugen, Bad reinigen oder Küchendienst... um halb 8 gab's Frühstück. Merkwürdigkeit: vor und nach dem Essen erstmal in zwei Reihen vor dem Eßtisch aufstellen und gemeinsam laut ein Vaterunser und ein Gegrüßet seist du, Maria beten – das Vaterunser kannte ich ja, den Mariengruß nicht. Wirklich seltsam. Nach dem Frühstück Schule oder Ausbildung – für mich hieß das erstmal: Praktikum in der Krabbelstube, das hatte ich mir aussuchen dürfen und ich hatte mich dafür entschieden, weil ich so kleine Hosenscheißer niedlich fand und es klang angenehmer, als ein Praktikum in der Wäscherei oder im Friseursalon. Ich war zwei Monate vor Beginn der Sommerferien nach St. Gabriel eingerückt, nach den Ferien sollte ich dann auf die Wirtschaftsschule, und weil ich eh schon zwei Jahre älter als die Klassenkameradinnen war, sollte ich bis dahin Buchhaltung, Steno und Maschinenschreiben so weit nachlernen, daß ich gleich in die 9. Klasse einsteigen könnte. Dafür wurde ich von einer anderen Gruppenschwester regelmäßig allein unterrichtet – so im Rückblick haben die sich wirklich ins Zeug geschmissen, um aus uns Mädels das Bestmögliche rauszuholen, kann ich nicht anders sagen.

Die Krabbelstube hat mich ziemlich ernüchtert: es war für die Kinder der Mädels aus dem Mütterheim, alle zwischen 1 – 3 Jahre. Von wegen, in dem Alter seien die noch nicht so anstrengend...

- hat eins geplärrt, haben alle geplärrt, hat eins mit Essen rumgepatscht, haben alle mit Essen rumgepatscht

- ne, hat schon irgendwie Spaß gemacht, aber nach den paar Wochen dort war ich reif für die Rente, die waren mir eindeutig über.
Als evangelisch erzogenes Mädel war ich in St. Gabriel ziemlich oft – ähm. Ich würd's mal „folkloristisch überfordert“ nennen. Seltsame Bräuche. Die Sache mit dem Gegrüßet seist du Maria kannte ich ja schon aus dem Fernsehen, daß jemand echt sowas aufsagt hatte ich nicht gedacht. Sonntags war Kirche angesagt: ohne Frühstück. Hat mich nicht begeistert, aber ich wollte mir so'n Gottesdienst schon anschauen. Allerdings: samstag Nachmittag ging ab 16 Uhr die „Einkehrzeit“ los, das heißt: keine Schulaufgaben mehr, kein Rumgealber, keine Musik mehr, „gemessenes Betragen“, was immer das sein sollte. Höchst merkwürdig. Am ersten Sonntag bin ich also in der Früh ganz bereitwillig mit in die Kirche getrabt, und das war für mich erstmal ziemlich unterhaltsam: vorne saßen die ganzen Schwestern, nicht nur die Gruppenschwestern, sondern überhaupt das ganze Kloster. Dann die Geschichte mit dem Knien und wieder Aufstehen (sowas machen die Evangelen nicht), der Pfarrer sah ziemlich bunt aus (bei den Evangelen ist die Kleidung schwarz mit einem weißen Kragen), lauter Gebimmel und Weihrauch (riecht komisch, ich mag's nicht) – also es war schon was geboten da, ich fand's interessant.
Und nach dem Gottesdienst zurück in die Gruppe, Frühstück, mein Magen knurrte schon, aber nix dergleichen: komische Stimmung, alle standen betreten im Vorraum, manche mit gesenkten Köpfen, die süße Gruppenschwester sah streng aus und sagte nix, von den anderen sagte auch niemand was, bis Sr. M. S. fragte, ob jemand etwas zu sagen hätte. Ein Mädel – meine mir zugewiesene „Bezugsperson“ für die Eingewöhnungsphase – meldete sich, und ich dachte, ich hätte mich verhört, als sie sagte: „Ich finde es nicht in Ordnung, daß die Franziska in Hosen in die Kirche gegangen ist“. Ey, das war ja ich! Ich dachte, ich spinne, und fing an zu lachen, konnte ja nur ein Witz sein so wie der Gag mit dem Schwimmbad. Aber außer mir lachte niemand, die meinten das tatsächlich ernst. Als mir das klar wurde, bin ich gewaltig stinkig geworden, weiß nicht mehr, wie viel ich dafür an Misereor spenden mußte, aber war wohl einiges.

Hätte mir ja vorher mal jemand sagen können, daß Rockpflicht in der Kirche herrschte – ich hatte sogar einen Rock, so ein Jeans-Dings, ziemlich abgewetzt und schlunzig, immerhin ohne Hosenbeine dran. Aber egal: ich dachte, die können mich mal, ich fand mich eh schon entgegenkommend, daß ich an diesem Gottesdienst überhaupt teilgenommen hatte, und dann sowas! Bin dann wütend ins Zimmer abgerauscht, überlegte wieder, wie ich am besten die Biege dort machen könnte, bis irgendwann die Schwester zu mir ins Zimmer kam, um mit mir zu reden. Na, ich ließ nochmal Dampf ab und erklärte, ich würde ab sofort die Kirche boykottieren. Und was tat die Frau? Lachte mich aus, sagte: „Du kannst meinetwegen ein Buch zum Lesen mitnehmen und dich in die letzte Bank setzen, wenn du willst – aber in die Kirche gehst du, und du wirst einen Rock dort tragen!“
Ok, die Frau hat gewonnen...

- ich hab genau ein Mal ein Buch mit in die Kirche mitgenommen, aber so weit hinten hab ich von der Veranstaltung wenig mitgekriegt, und ich fand diese katholischen Gottesdienste doch ziemlich... tja. Also ich hab nachgegeben.

Wenn ich mir das so durchlese, muß sich das alles ziemlich schlimm anhören, aber das war's eigentlich nicht. Ich hab mich dort relativ bald ziemlich wohl gefühlt. Ich fand das Eingesperrtsein Scheiße, ich mochte es auch nicht, kaum je allein sein zu können, ich mochte diese durchreglementierten Tage nicht: Musik hören nur nach dem Mittagessen eine halbe Stunde und Freitag abends für eine Stunde (Schlager der Woche

), alles war so minutiös geplant!
Aber: nie ist eine Schwester dort laut geworden, nie wurden wir geschlagen, die Schwestern haben sich Zeit genommen, mit uns zu reden – richtig zu reden, so mit Sympathie und Zuneigung... das war echt der Knaller, ich dachte erst, die verarschen uns. Es gab sogar eine Schwester für jedes Mädel, das die Betschwester war. Dachte auch hier: ist wohl ein Witz, sowas gibt’s nicht. Gab's aber doch, meine Betschwester war eine über 80-jährige, lebhafte Schwester aus dem Kloster, die immer gelacht hat, sowas herzliches wie die hatte ich noch nirgends erlebt. Die hat mir erklärt, daß sie jeden Abend mich in ihre Fürbitten an Gott mit einschließt. Und manchmal hat mir diese Schwester ein Heiligenbildchen mit irgend 'nem Spruch drauf geschenkt. Fand ich irgendwie nett, auch wenn ich die Bildchen nur als Lesezeichen brauchen konnte.
Innerhalb des Heimes gab's neben der Wirtschaftsschule auch noch eine Hauptschule, einen Friseursalon, eine Wäscherei, eine Schneiderei – alles Ausbildungsbetriebe – sowie eine Großküche, in der gekocht wurde. In den Schulen waren externe Lehrkräfte, es waren staatlich anerkannte Privatschulen mit nicht mehr als 10 Mädels je Klasse. Ziemlicher Luxus, ne?

Ein Zeichen für die Aufgeschlossenheit des Ordens: unser BWL-Lehrer war Evangele, unsere Deutsch-Lehrerin konfessionslos und geschieden. Überhaupt waren die Schwestern überwiegend moderne, aufgeschlossene, am Leben orientierte Frauen, dieser
Orden ist 1829 gegründet worden, um Prostituierten bei der Rückkehr in ein bürgerliches Leben zu helfen. Weltfremd waren diese Schwestern wirklich nicht, sie sind uns mit Zuneigung und ehrlichem Respekt begegnet – zumindest ich hab's so empfunden, gab natürlich auch Mädchen, die das nicht so empfanden.
Sehe schon – wird wieder so lang, ich weiß gar nicht, ob das für euch interessant ist – gibt noch einiges zu erzählen, aus unserem Alltag dort, aber für heute erstmal genug.


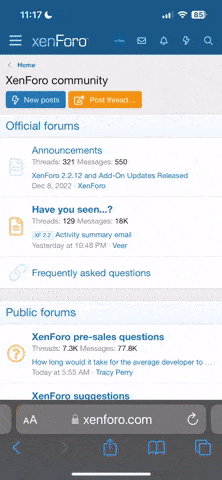


 <-- gut aufheben bitte, bin ziemlich geizig mit sowas.
<-- gut aufheben bitte, bin ziemlich geizig mit sowas. 

