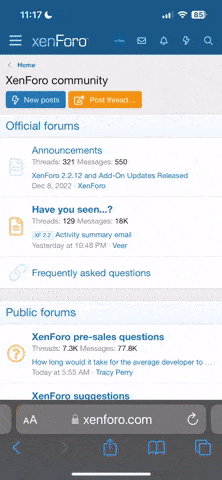Zuckermanns These: Der Vorwurf des Antisemitismus und die „Instrumentalisierung der Schoah-Erinnerung“ dienten „israelisch-jüdischen Lobbys“ als „Totschlag-Ideologem“, als „Instrument, ihre Gegner mundtot zu machen“. Damit würde die israelische Politik u.a. von der „Besatzungsbarbarei“ ablenken, von „Alltagsrassismus“, den Zuckermann in Israel sieht. Vor allem von den Deutschen, die an den Juden Ungeheures verbrochen haben, werde diese Strategie nur allzu leicht akzeptiert: Sie hätten, so Zuckermann, „,Juden‘ zu ihrem psychohistorischen Fetisch erhoben“ und gehorchten der Maxime „Right or wrong, their country“. So wollten sie „an Israel gutmachen, was sie an den Juden verbrochen haben“. Arabischer Antisemitismus sei etwas ganz anderes, habe mit europäischem Antisemitismus nichts zu tun.
Zuckermann selbst ist der Sohn polnischer Holocaust-Überlebender. Er wolle mit seiner „Diskursanalyse“, wie er das Buch nennt, auch helfen, das Gedenken an die Schoah zu bewahren, sagte er bei der Diskussion. Mit Begriffen wie „struktureller Antisemitismus“ und durch die Vermengung mit dem Begriff „Antizionismus“ werde der mörderische Judenhass gefährlich relativiert. Es könne der Gesellschaft gehen wie dem Mädchen im Märchen, das so lange „Wolf!“ schreit, bis sie niemand mehr ernst nimmt, wenn der Wolf wirklich kommt.
http://diepresse.com/home/kultur/literatur/624473/Wiener-Uni_Heftige-Debatte-ueber-Antisemitismus