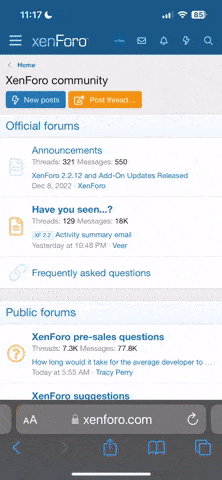Im Herbst 2014 sprach man von einer vorsorglichen Kreditlinie für Griechenland von gut 10 Milliarden Euro, nun von einem Hilfsprogramm von gut 80 Milliarden. Was ist passiert?
Es ist noch kein Jahr her, aber es erscheint als ferne Vergangenheit: Nach der Sommerpause 2014 gewann die Diskussion an Fahrt über allfällige Anschlussregelungen für das zweite Hilfsprogramm für Griechenland, dessen europäischer Teil Ende Dezember 2014 auslaufen sollte. Der damalige griechische Ministerpräsident Andonis Samaras liebäugelte mit einem clean exit: Er wollte keinerlei Nachfolgeregelung, um die verhassten Auflagen und Kontrollen abzuschütteln. Am liebsten wäre er gleich auch den Internationalen Währungsfonds (IWF) losgeworden, dessen Programm bis März 2016 konzipiert ist.
Der Weg nach unten
Samaras hatte einige Argumente auf seiner Seite. In den ersten drei Quartalen 2014 war das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem jeweiligen Vorquartal erstmals wieder gewachsen, im Primärhaushalt zeichnete sich ein Überschuss und bei manchen Zielen des Programms eine Übererfüllung ab. Es schien möglich, dass sich der Staat 2015 wieder genug Geld auf den Finanzmärkten würde beschaffen können. Vertreter der Kreditgeber blieben dennoch vorsichtig. Sie hätten ein Sicherheitsnetz in Form einer vorsorglichen Kreditlinie des Euro-Krisenfonds ESM bevorzugt, die Athen nötigenfalls hätte anzapfen können. Ihre bloße Existenz würde die Anleger beruhigen, hofften sie. Nach Turbulenzen an den Märkten begann auch die Regierung Samaras umzudenken. Anfang November beriet die Eurogruppe erstmals über ein Sicherheitsnetz. Eine der Optionen war, einen für Bankenhilfen vorgesehenen, aber nicht benutzten Rest des zweiten Programms von 10,9 Milliarden Euro in ein Sicherheitsnetz umzuwandeln, verbunden mit vergleichsweise leichten Auflagen.
Zugleich kam aber die Ende September eingeleitete letzte Überprüfung des Programms durch die Troika, deren Abschluss Bedingung für die Auszahlung der letzten europäischen Kredittranche gewesen wäre, nicht vom Fleck. Die Reform- und Sparanstrengungen hatten nachgelassen, wohl auch mit Blick auf die anstehende Präsidentschaftswahl. Wie sich später zeigte, sank im vierten Quartal das BIP wieder. Im Dezember verlängerten die Euro-Staaten das Programm bis Ende Februar, da ein rechtzeitiger Abschluss der Überprüfung unmöglich schien.
Ende Dezember scheiterte die Präsidentschaftswahl, was zu Parlamentswahlen im Januar führte. Sieger war das Linksbündnis Syriza des heutigen Premierministers Alexis Tsipras. Dieser und sein inzwischen zurückgetretener Finanzminister Yanis Varoufakis überzogen die Kreditgeber zunächst mit einer Tirade von Kritik und Belehrungen, ohne dass sie aber das Hilfsprogramm kündigten. Sie wussten, dass sie die anstehenden Rückzahlungen nicht aus eigener Kraft leisten könnten, und einen Staatsbankrott mit anschließend drohendem Grexit wollten sie doch nicht riskieren. Stattdessen verlängerte man das europäische Programm um weitere vier Monate bis Ende Juni, um Zeit zu schaffen für seinen ordentlichen Abschluss und Gespräche über eine Nachfolgeregelung. Schon damals hieß es in EU-Kreisen, statt eines Sicherheitsnetzes sei wohl ein drittes Hilfsprogramm nötig. Bald sprach man von einem Umfang von 30 bis 50 Milliarden Euro. Begründet wurde dies mit dem Reformstillstand, der gegen Ende der Ära Samaras eingesetzt hatte, und mit der Unsicherheit über Tsipras Kurs.
Doch die Geber und die griechischen Behörden stritten bis Ende Juni ergebnislos über die Auflagen für die Hilfe. Schlussendlich brach Tsipras die Verhandlungen ab. Seit Anfang Juli steht der Staat ohne Schutzschirm da, er ist im Zahlungsrückstand gegenüber dem IWF, und er schloss vor über zwei Wochen die Banken. Erst in dieser dramatischen Lage hat sich Tsipras am Montag mit den anderen Euro-Staaten auf Verhandlungen über ein drittes Hilfsprogramm verständigt.
Gesalzene Rechnung für beide
Die Rechnung ist für beide Seiten gesalzen. Statt von einem Mittelbedarf von 30 bis 50 Milliarden Euro spricht man nun von 82 bis 86 Milliarden Euro. Zurückzuführen ist dies auf die Verschlechterung der Wirtschaftslage, den Stillstand und einige Rückschritte bei den Reformen und vor allem auf die Banken: Der massive Abzug von Einlagen und zuletzt die Schließung hat sie in eine derart missliche Lage gebracht, dass das neue Programm zehn bis 25 Milliarden Euro für die Rekapitalisierung oder Abwicklung von Banken enthalten soll. Gestiegen sind die Kosten aber vor allem auch für die griechische Bevölkerung: Laut der jüngsten EU-Analyse könnte das BIP 2015 um zwei bis vier Prozent sinken, und jeder Tag, an dem die Banken geschlossen bleiben, erhöht den Schaden.
Hat sich das Verhandeln bis zehn nach zwölf wenigstens gelohnt, wenn man das Resultat an den Wahlkampfversprechen von Syriza misst? Im Gegenteil. Das neue Programm wird noch mehr Auflagen enthalten als das zuvor von Tsipras abgelehnte Paket, da sich die Wirtschaftslage weiter verschlechtert hat und die Geber viel Vertrauen in die Regierung Tsipras verloren haben. Sie verlangen erhebliche Vorleistungen, bevor auch nur Verhandlungen über das Programm beginnen. Schließlich wird Griechenland weder den IWF noch die Troika los: Laut der Vereinbarung vom Montag soll sich Ersterer über März 2016 hinaus am Programm beteiligen, und die Troika darf die Umsetzung der Reformen künftig wieder vor Ort in Athen überprüfen, auch wenn sie wohl weiter unter dem Namen Institutionen segeln wird.