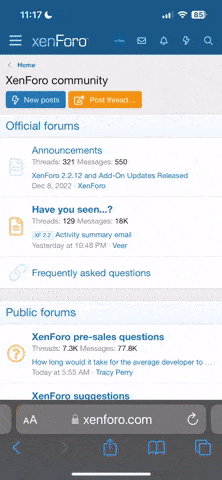Heinz Fischer hat immer gewartet, bis die Gefahr vorbei ist. In innerparteilichen Auseinandersetzungen genauso wie in den Wechselspielen sozialpartnerschaftlicher Gewichtsverschiebungen, durch die die österreichische Politik in all den Nachkriegsjahrzehnten, in denen Fischer Teil dieses Systems war, geprägt wurde. Würde man mithilfe eines hochkomplexen Algorithmus herausfinden wollen, wo genau die Grenze zwischen Feigheit und Klugheit verläuft, so würde der dafür gebaute Supercomputer immer dasselbe Ergebnis ausspucken: Diese Grenze befindet sich immer dort auf der politischen Landkarte, wo sich Heinz Fischer gerade befindet.
Das hat ihm im Laufe seiner politischen Karriere viel berechtigte Kritik eingebracht Bruno Kreiskys Diktum, dass Heinz Fischer immer dann, wenn man ihn gerade einmal brauche, am Klo anzutreffen sei, gehört zum Kernbestand des österreichischen Anekdotenschatzes. Es wäre freilich falsch, Heinz Fischer vorzuwerfen, dass er keinen erkennbaren ideologischen Standpunkt habe, im Gegenteil: Im Unterschied zur derzeitigen Führungsschicht seiner Partei war er immer ein Vertreter der sozialistischen Orthodoxie. Fischer hat nur immer besser als alle anderen gewusst, dass ein zu exzessives Ausleben von Risikobedürfnissen zum Amtsverlust führen kann. Seine spezifische Form der Askese hat sich für ihn immer bezahlt gemacht. Zu Recht: Wie soll man denn die Welt zum Besseren verändern, wenn man kein Amt mehr hat?